Die Anfänge des Genossenschaftswesens und die Gründung der Imkergenossenschaft
 Die Gründung der Imkergenossenschaft fiel mit der schwierigsten Wirtschaftssituation des Landes seit der Erlangung seiner Unabhängigkeit im Jahre 1918 zusammen.
Die Gründung der Imkergenossenschaft fiel mit der schwierigsten Wirtschaftssituation des Landes seit der Erlangung seiner Unabhängigkeit im Jahre 1918 zusammen.
Die schwierige sozioökonomische Situation spiegelte sich auch im Bereich der Imkerei wider und prägte stark die Idee und die Praxis des Genossenschaftswesens. Seine Anfänge gehen auf das verarmte Milieu der britischen Weber im 19. Jahrhundert zurück, die 1842 in Rotchdale in England die erste Konsumentengenossenschaft gründeten. Der Armut stellte daher einen verzweifelten Impuls dar, um durch gemeinschaftliches organisiertes Handeln aus der Not herauszukommen, und zwar in einer Form, die seither als „genossenschaftlich“ bezeichnet wurde.
Die dynamische Entwicklung des Genossenschaftswesens prägte die Volkswirtschaften zahlreicher europäischer Staaten.
Nach 1920 sind verschiedene Imkerverbände entstanden, die an organisatorische Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert anknüpften und nach Wirtschaftsinitiativen griffen, um den Honigabsatz zu erleichtern. Die ersten Bemühungen der Imker um die Gründung einer Genossenschaft gehen auf das Jahr 1925 zurück, wobei sie sich zunächst auf die Sensibilisierung der Funktionäre des Wojewodschaftsverbands der Landwirtschaftlichen Kreise und der Landwirtschaftskammer in Lublin für diese Aufgabe beschränkt haben. Die Aktivierung der Imker verlief erfolgreich und am 18. Mai 1932 erfolgte das Gründungstreffen der Genossenschaft unter Anwesenheit von 15 Gründungsmitgliedern, unter dem Namen “Imkerverband”. Bei dieser Versammlung wurde die Satzung verabschiedet, in der im Art. 3 der Geschäftszweck der Genossenschaft bestimmt wurde: „ Ziel der Genossenschaft ist die Erhöhung des Wohlstands sowie des Zustands der Bienenstände ihrer Mitglieder wie auch das Zusammenwirken bei deren kultureller Entwicklung”. Eine wesentliche Rolle bei der Aufgabenstellung der Genossenschaft spielte von Anfang an der Kultur- und Bildungsaspekt: „Die Genossenschaft nimmt in moralischer und materieller Hinsicht einen regen Anteil an der Arbeit im Kultur- und Bildungsbereich”.



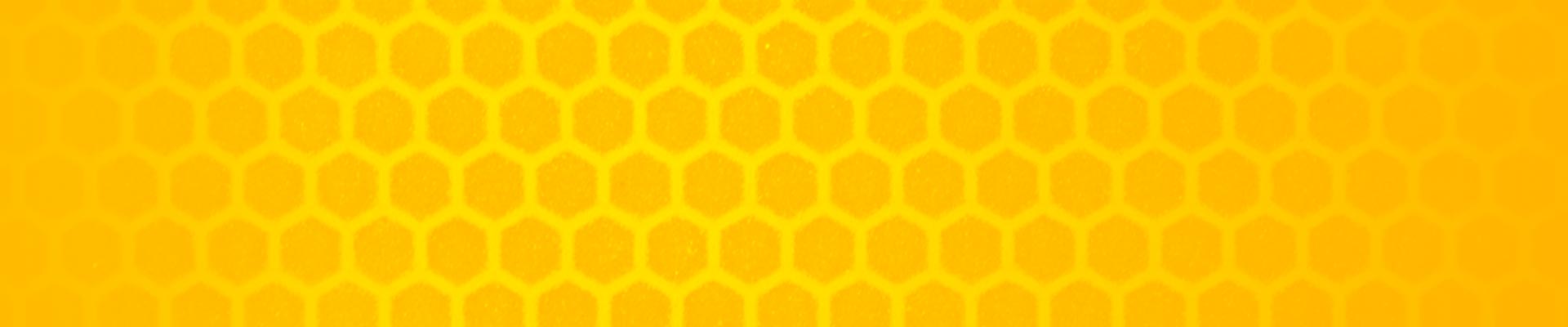
 Die Gründung der Imkergenossenschaft fiel mit der schwierigsten Wirtschaftssituation des Landes seit der Erlangung seiner Unabhängigkeit im Jahre 1918 zusammen.
Die Gründung der Imkergenossenschaft fiel mit der schwierigsten Wirtschaftssituation des Landes seit der Erlangung seiner Unabhängigkeit im Jahre 1918 zusammen.

